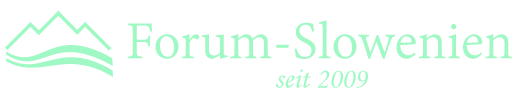http://science.orf.at/stories/1629853/ hat geschrieben:Gottscheer: Eine Geschichte, viele Identitäten
Die Gottschee ist ein Gebiet rund 60 Kilometer südöstlich von Ljubljana. Die Gottscheer leben hier seit dem Mittelalter, heute zählen sie zu den kleinsten deutschsprachigen Minderheiten. Welche Identitäten diese lange Geschichte - inklusive massiver Verstrickungen in den Nationalsozialismus - hervorgebracht hat, hat ein Wiener Historiker untersucht.
Sein Resümee: Trotz gegenteiliger Versuche der offiziellen Landsmannschaften gibt es nicht die eine, gemeinsame Identität. Die unterschiedlichen Erfahrungen von Migration, Vertreibung und Nazizeit finden auf konkurrierenden Webseiten ihren Ausdruck, die Georg Marschnig analysiert hat.
Eine Volksgruppe sterbender Europäer
Der Schriftsteller Karl-Markus Gauß hat ihnen in seinem Buch "Die sterbenden Europäer" ein Kapitel gewidmet und damit gleich eine Prognose für ihre Zukunft geliefert: den Gottscheern, jener kleinen deutschsprachigen Volksgruppe im Süden von Slowenien, deren Wurzeln bis ins 14. Jahrhundert reichen und die zum Teil bis heute ihren kaum mehr verständlichen mittelhochdeutschen Dialekt sprechen.
Ihren Namen beziehen die Gottscheer vermutlich von "koča", dem slowenischen Wort für Hütte. "Die slowenischen Einwohner haben die Siedlung der deutschen Neuankömmlinge als Hüttensiedlung bezeichnet", sagte Marschnig gegenüber science.ORF.at. Der Historiker von der Universität Wien hat sich in seiner Dissertation mit Geschichte und Identitätskonstruktion der Gottscheer beschäftigt.
Migration, Umsiedlung, Vertreibung
Ihren numerischen Höhepunkt erreichten die Bewohner der Sprachinsel um 1880, als rund 28.000 Menschen die zweisprachige Region rund um das Städtchen Gottschee bevölkerten. In den folgenden Jahren setzte aber eine beispiellose Auswanderungsbewegung nach Nordamerika ein. Heute leben nur noch 50 bis 200 Menschen im historischen Gottschee, wie Marschnig schätzt.
Durften sich die Bewohner in der Donaumonarchie noch zum "Staatsvolk" zählen, wurden sie ab 1918 im SHS-Staat zu Angehörigen einer nationalen Minderheit. Die darauffolgende Verschlechterung der Situation - Schulen wurden geschlossen, die eigene Sprache durfte zum Teil nicht mehr verwendet werden - ließ die vor allem bäuerlichen und christlich-sozialen Gottscheer in Scharen zu den Nationalsozialisten überlaufen.
Als die Nazis dann an der Macht waren, begeisterten sie sich an einem der vielen wahnwitzigen Umsiedlungsprojekte der Nationalsozialisten. Im Winter 1941/42 wurden fast alle der damals rund 12.000 Gottscheer in ein anderes Gebiet des heutigen Slowenien umgesiedelt, aus dem zuvor Zehntausende Slowenen deportiert worden waren. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs flüchtete ein Großteil nach Österreich, viele emigrierten auch weiter in die USA.
Einwanderungsgeschichte vs. Vertreibungserzählung
In den neuen Heimatgebieten wurden verschiedene Vereine gegründet, die ihre Traditionen pflegten und ihre Identität erhalten wollten - und genau hier setzt das Interesse des Historikers Marschnig ein. Diese Identität ist nämlich alles andere als eindeutig und unumstritten.
"Die offizielle Vertretung geht zwar von einer gemeinsamen Identität aus, die Erzählungen der Menschen zeigen aber einen starken Unterschied zwischen den US-Gottscheern und jenen in Slowenien bzw. jenen, die heute in Österreich leben. In Amerika dominieren klassische Einwandererzählungen, da geht es um Leid, Heimweh, sozialen Aufstieg, das erste Eigenheim oder Clubhaus etc. Bei den deutschsprachigen Gottscheern hingegen wird vor allem an die Mühen und die Not der Vertreibung erinnert", so Marschnig.
Widersprüche ethnischen Denkens
Von einer eindeutigen Identitätskonstruktion sei nicht zu sprechen, es gebe mehrere Schichten. "Die Gottscheer definieren sich zur gleichen Zeit über Sprache und Tradition als Deutsche, über ihre Angehörigkeit zur Donaumonarchie und über ihre Verwandten in Amerika."
Wie kann das sein, dass sich ethnisch denkende Nationalsozialisten freiwillig umsiedeln lassen und sich zugleich bereits die Mehrheit der eigenen Volksgruppe in einem fremden - noch dazu multiethnischen - Land wie den USA aufhält?
Marschnig: "Alltagsleben und Politik sind oft zwei verschiedene Dinge, die sich nicht berühren müssen. Man kann mit einem Bruder in den USA Briefkontakt halten und dennoch auf das eigene Deutschtum pochen. Das ist im praktischen Leben kein Widerspruch."
Internet bringt Deutungshoheit ins Wanken
Die offizielle Version vom Leid der Vertreibung wird laut Marschnig von der "Gottscheer Zeitung" hochgehalten. Wie bei anderen Themen auch hat das Internet dieses Monopol ins Wanken gebracht. "Im Web können heute die verschiedenen Geschichten erzählt werden. Nun zeigt sich auch öffentlich, dass man nicht von nur einer Identität - die ja auf geteilten Erzählungen basiert - ausgehen kann."
Den distanziertesten Blick auf die eigene Geschichte weisen laut Marschnig Gottscheer Webseiten aus Nordamerika auf wie Gottscheer Heritage and Genealogy Association, New York Gottschee und der Gottscheer Club of Cleveland. "Sie versuchen, eine Vogelperspektive einzunehmen, und erzählen sowohl die Geschichten der Vertreibung als auch von der Mitgliedschaft bei den Partisanen, die es auch gegeben hat. In erster Linie werden aber die Erfahrungen in der neuen Heimat geschildert. Zumeist geht es in den Foren auch um Genealogie, also die Frage, wo die Familien herkommen."
Gottscheer-Sein in Amerika verstehe sich dabei als Teil einer größeren europäischen Einwandererkultur und sei Ausdruck eines vorherrschenden "Schmelztiegel-Denkens".
Kampf um die Erinnerung
Ganz anders verhält es sich mit den deutschsprachigen Gottscheer-Webseiten, auf denen eher ein "Kampf um die Erinnerung " ausgetragen wird. Die offizielle Seite der Arbeitsgemeinschaft der Gottscheer Landsmannschaften erzählt eine Opfergeschichte, der zufolge "die Gottscheer keine andere Wahl hatten, als unter Zwang ihr geliebtes Heimatland zu verlassen".
Währenddessen werden auf Gottschee.de auch "Erinnerungen publik gemacht, die sich diametral gegen diese 'offizielle' Erzählung wenden", wie Marschnig in einem Buchbeitrag schreibt. Konkret werden hier auch die massiven Verstrickungen in den Nationalsozialismus erwähnt.
In den Foren dieser Website wird über die Versionen der Geschichte gestritten. "Es geht hin und her, der Kampf um die Erinnerung ist noch nicht beendet. Und das wird sich auch so bald nicht ändern", ist Marschnig überzeugt.
Die Gottscheer
Moderator: Trojica
-
France Prešeren
Thema-Ersteller - Gehört zum Foruminventar
- Beiträge: 5766
- Registriert: 13. Jun 2009 13:34
- Geschlecht: männlich
- Slowenischkenntnisse: Umgangssprachlich (Smalltalk)
- Wohnort: Novo mesto
- Hat sich bedankt: 505 Mal
- Danksagung erhalten: 999 Mal
- Gender:

Okt 2009
21
20:53
Die Gottscheer
Ein bisschen was zu der alten deutschen Minderheit in SLO.
Nazadnje še, prijatlji,kozarce zase vzdignimo,ki smo zato se zbrat'li,ker dobro v srcu mislimo.
Erstelle einen Zugang oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst registriert sein, um kommentieren zu können
Erstelle einen Zugang
Kein Mitglied? Registriere dich jetzt
Mitglieder können kommentieren und eigene Themen starten
Kostenlos und dauert nur eine Minute
Anmelden
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste